Barrierefreiheitsstärkungsgesetz
Mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) wird die digitale Zugänglichkeit zur Pflicht. Unternehmen sind künftig verpflichtet, ihre digitalen Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie auch für Menschen mit Einschränkungen nutzbar sind. Dazu zählen unter anderem Webseiten, Online-Shops, mobile Apps, Selbstbedienungsterminals sowie digitale Geräte wie E‑Reader, Bankautomaten oder Zahlungssysteme.
Das Gesetz verfolgt ein klares Ziel: Es soll die digitale Teilhabe für alle Menschen gewährleisten. Für Unternehmen bedeutet das eine klare Verantwortung – wer digitale Angebote bereitstellt, muss sicherstellen, dass diese ohne Barrieren zugänglich sind. Wer nicht vorbereitet ist, riskiert spürbare rechtliche und wirtschaftliche Folgen.
Was regelt das Gesetz?
Webseiten und E-Commerce-Plattformen
Mobile Anwendungen
Messenger-Dienste und digitale Kundenkommunikation
Buchungs-, Zahlungs- und Informationssysteme im Personenverkehr
Selbstbedienungsterminals wie Bank- oder Fahrkartenautomaten
Digitale Geräte wie Tablets, Lesegeräte und Kassensysteme
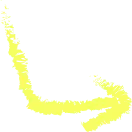
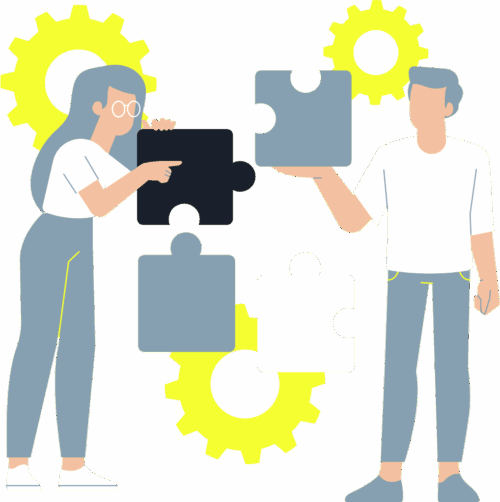
Wer is betroffen?
Die Regelungen gelten für Hersteller, Händler und Dienstleistungsanbieter. Ob ein Angebot physisch oder digital bereitgestellt wird, ist dabei unerheblich. Auch Unternehmen, die lediglich digitale Geräte vertreiben oder Software verkaufen, sind zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben verpflichtet.
Für Kleinstunternehmen gibt es unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen – allerdings nur im Dienstleistungsbereich und nur dann, wenn bestimmte Umsatz- und Mitarbeitergrenzen nicht überschritten werden. Wer digitale Produkte vertreibt, ist unabhängig von der Unternehmensgröße zur Umsetzung verpflichtet.
Auch für Unternehmen im B2B-Segment kann das Gesetz relevant werden. Etwa dann, wenn Kunden über Geschäftspartner auf nicht barrierefreie Inhalte stoßen und daraus rechtliche Schritte entstehen.
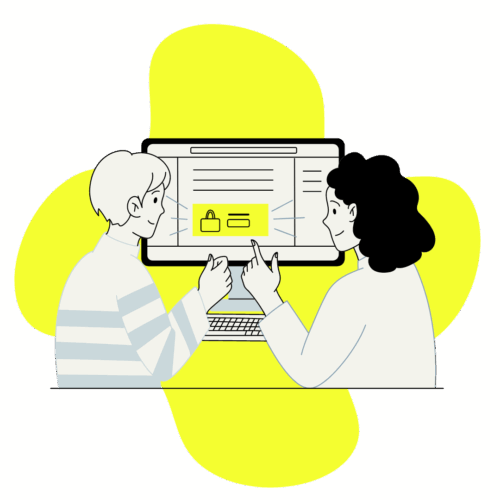
Umsetzungspflicht und Fristen
Für neue digitale Angebote gilt: Sie müssen den gesetzlichen Anforderungen unmittelbar entsprechen. Für bestehende Systeme und Plattformen gibt es Übergangsregelungen, die eine schrittweise Anpassung ermöglichen. Bei bestimmten Geräten – beispielsweise Ticketautomaten – gelten zum Teil verlängerte Fristen.
Allerdings sollte man die zeitliche Flexibilität nicht überschätzen. Barrierefreiheit ist ein komplexes Thema, das nicht kurzfristig gelöst werden kann. Wer sich zu spät damit beschäftigt, läuft Gefahr, aufwändige Nachbesserungen, operative Engpässe oder technische Kompromisse in Kauf nehmen zu müssen. Eine frühzeitige Planung sichert hier langfristig Stabilität.

Folgen bei Nichtbeachtung
Die Einhaltung des Gesetzes wird durch zuständige Behörden überwacht. Unternehmen, die die Anforderungen nicht umsetzen, müssen mit spürbaren Konsequenzen rechnen. Dazu zählen:
Bußgelder von bis zu 100.000 Euro
Abmahnungen durch Wettbewerber oder Interessenvertretungen
Vertriebsverbote für nicht-konforme Produkte
Reputationsverluste durch negative Berichterstattung
Risiken bei Partnerschaften oder Ausschreibungen
Auch Nutzerinnen und Nutzer haben die Möglichkeit, Verstöße zu melden und Beschwerden einzureichen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Intransparenz oder Nicht-Umsetzung nicht folgenlos bleibt.
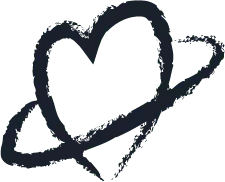
Warum Barrierefreiheit auch wirtschaftlich relevant ist
Barrierefreiheit ist längst kein reines Compliance-Thema mehr. Sie hat direkte Auswirkungen auf die Nutzererfahrung, auf Reichweite und nicht zuletzt auf den Unternehmenserfolg.
Ein barrierefreies digitales Angebot ist für alle Nutzer einfacher zugänglich – nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für Personen mit temporären Einschränkungen, ältere Menschen oder Nutzer mobiler Endgeräte. Gleichzeitig erfüllen barrierefreie Websites viele Kriterien, die auch für Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Optimierung entscheidend sind: saubere Struktur, klare Navigation, gut lesbare Inhalte.
Wer frühzeitig in Barrierefreiheit investiert, handelt vorausschauend, erschließt neue Zielgruppen und stärkt die eigene Position im Markt. Die gesetzliche Verpflichtung macht das Thema unumgänglich – die strategischen Vorteile machen es lohnenswert.
FAQ
Gilt das Gesetz auch für kleine Unternehmen?
Teilweise. Bei Dienstleistungen gibt es Ausnahmen für Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und einem Jahresumsatz unter 2 Mio. €. Bei physischen Produkten gelten diese Ausnahmen nicht.
Was bedeutet „barrierefreie Website“ konkret?
Eine barrierefreie Website ist so gestaltet, dass sie von allen Menschen genutzt werden kann – unabhängig von körperlichen, sensorischen oder kognitiven Einschränkungen. Dazu gehören z. B. verständliche Inhalte, ausreichender Farbkontrast, Tastaturbedienbarkeit und Screenreader-Kompatibilität.
Welche Normen sind einzuhalten?
Damit eine Website als barrierefrei gilt, muss sie bestimmten technischen Regeln folgen. Die wichtigste Grundlage ist die Norm EN 301 549. Sie legt fest, was bei digitalen Angeboten beachtet werden muss, damit sie für alle Menschen zugänglich sind – auch für blinde, gehörlose oder motorisch eingeschränkte Personen.
Dazu gehören zum Beispiel klare Texte, gute Lesbarkeit, einfache Bedienung (auch ohne Maus) und dass Inhalte von Vorleseprogrammen (Screenreadern) verstanden werden können.
Zusätzlich gibt es internationale Regeln namens WCAG 2.1, die genau erklären, wie Websites aufgebaut sein sollten. In Deutschland gilt außerdem die BITV 2.0, die diese Regeln in deutsches Recht überträgt.
